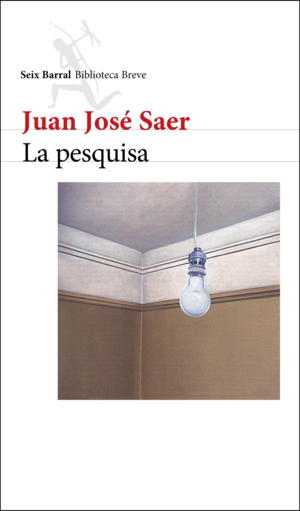Die Entdeckung des Typoskripts stürzte, wie man sich leicht vorstellen kann, Washingtons Freunde in helle Aufregung und von den vielen Rätseln, die die achthundertfünfzehn Seiten bergen, ist die Identität des Verfassers sicherlich eines der dunkelsten. (…)
Allerdings wurden die Seiten, wer weiß wann, ohne einen einzigen Absatz beschrieben, es bestand also keinerlei Untergliederung in Teile, Kapitel oder Abschnitte, und selbst Punkte am Satzende waren selten und eher oberflächlich gesetzt; Pichón schätzte, daß gerade einmal alle dreißig oder vierzig Seiten einer vorkam. Zuerst schloß er aus der visuellen Prüfung beziehungsweise aus der typographischen Beschaffenheit des Textes, daß dieser keinen einzigen Dialog aufwies; als er ihn jedoch etwas näher betrachtete, konnte er sehen, daß es in Wirklichkeit sehr viele Dialoge gab, die nur immer in der indirekten Rede wiedergegeben wurden. Die Sätze waren von unterschiedlicher Länge: Zum Teil waren es kurze Sätze, dann wechselten sich kurze und lange Sätze ab, und manchmal wuchsen die Sätze an, bis sie eine Länge von ein oder zwei Seiten erreichten, was dann am Ende scheinbar immer einen Punkt zur Folge hatte. Wer auch immer der Verfasser gewesen sein mochte – bis zu ebendiesem – bis zu ebendiesem Moment, in dem sie am Tisch sitzen und er, Tomatis und Soldi das erste Bier des Abends trinken, ist ihm noch kein einziger Name eingefallen –, der Autor schien weder, durch den systematischen Gebrauch kurzer Sätze, dem Aberglauben der Zweckmäßigkeit anzuhängen noch durch ausschließliches Konstruieren endloser Satzreihen dem barocken Vulgarisieren verfallen gewesen zu sein. Mit wohlwollender Voreingenommenheit, denn er hatte den Roman ja noch nicht gelesen, schrieb Pichón dem unbekannten Autor die Fähigkeit zur rhythmischen Modulation zu, dank der jeder Satz den ihm angemessenen Umfang hatte, der auf einer möglichst vollkommenen Übereinstimmung von Klang und Bedeutung beruhte und nicht etwa auf abstrakten Prinzipien einer vermeintlichen Romanästhetik oder einer angeblichen Weltanschauung, wie man es nennt, die dem Schreiben vorausgingen.
Juan José Saer: Ermittlungen, übers. von Hanna Grzimek, Köln: DuMont 2005, S. 58, 67f.
Zitate im Original
»Entre los amigos de Washington, el descubrimiento del dactilograma produjo, de más está decir, un revuelo desmesurado, y de los muchos enigmas que encierran las ochocientas quince páginas, la identidad del autor es uno de los más densos. (…)
Es cierto que las hojas fueron llenadas, quién sabe cuándo, a un solo espacio, que no existe ninguna división en partes, capítulos y secciones, y que los puntos y aparte son infrecuentes de un modo superficial, Pichón ha calculado que hay uno cada treinta o cuarenta páginas. La primera conclusión que ha sacado del examen visual del dactilograma, o de su disposición tipográfica, más bien es que la novela no incluye un solo diálogo, pero después, adentrándose un poco más en el texto, ha podido verificar que, a decir verdad, hay muchísimos, aunque transcriptos siempre en forma indirecta. Las frases son de extensión diferente: a veces hay frases cortas, a veces las frases cortas y las largas alternan, y a veces la extensión de las frases va aumentando, hasta alcanzar la extensión de una o dos páginas, lo que parece dar siempre lugar al punto y aparte. Quienquiera haya sido el autor —hasta este mismo momento en que están sentados a la mesa tomando la primera cerveza de la noche con Soldi y Tomatis no se le ha ocurrido todavía ningún nombre— no da la impresión de adherir, por el uso sistemático de la frase corta, a la superstición de la eficacia ni, por practicar en forma exclusiva los períodos interminables, al barroco de vulgarización. Por un prejuicio favorable, ya que todavía no ha leído la novela, Pichón le atribuye al autor desconocido una capacidad de modulación rítmica gracias a la cual cada frase tiene la extensión que le corresponde, basándose en la identificación lo más completa posible de sonido y sentido, y no en principios abstractos de una supuesta estética del relato y una pretendida visión del mundo como le dicen, anteriores al momento de la redacción.« (Juan José Saer: La pesquisa, Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta 1994, S. 67, 78f.)