Ricardo Piglia
Ricardo Piglia
(Geb. 1941 in Adrogué, gest. 2017 in Buenos Aires)
Ricardo Piglias Leben war von zahlreichen Ortswechseln und politischen Umbrüchen in seiner Heimat Argentinien geprägt. In Buenos Aires arbeitete er als Verleger und gab die Kriminalromanreihe Seria Negra und verschiedene Zeitschriften heraus. 1966, mit Beginn der Diktatur von Juan Carlos Onganía, wanderte Piglia in die USA aus, wo er neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller vor allem als Literaturkritiker in Erscheinung trat. Sein Wirken als Universitätsprofessor führte ihn unter anderem an die Universitäten Harvard und Princeton, 2011 kehrte er nach Buenos Aires zurück. Mit seinem 1980 erschienenen Roman Respiración artificial (dt. Künstliche Atmung, 2002) sicherte er sich einen Platz im Kanon der Gegenwartsliteratur Südamerikas. Der Roman, in dem sich individuelle Schicksale mit dem größeren Ganzen der argentinischen Geschichte verflechten, zeigt politische und soziale Missstände in der Militärdiktatur auf. Nicht nur in dieser Hinsicht gilt Piglias Roman als bemerkenswerteste Publikation während der Zensur dieser Zeit.
Der junge Schriftsteller Emilio Renzi, eine bei Piglia wiederkehrende Figur, macht sich auf die Suche nach seinem mysteriösen Onkel, Professor Marcelo Maggi, der sich seinerseits der endlosen Aufgabe widmet, den Nachlass von Enrique Ossorio, dem ehemaligen Sekretär des Diktators Rosas, zu entziffern. Die Romanhandlung erschließt sich aus Renzis und Maggis Briefwechsel, aus poetischen, philosophischen und politischen Gesprächen, in denen häufig Aussagen Dritter wiedergegeben werden, u. a. Ossorios:
Doch, schrieb Ossorio selbst (schreibt Maggi mir), was ist das Exil anderes als eine Form der Utopie? Der Verbannte ist der utopische Mensch schlechthin, schrieb Ossorio, schreibt Maggi mir, er lebt in ständiger Sehnsucht nach der Zukunft.
Ricardo Piglia: Künstliche Atmung, übers. von Sabine Giersberg, Berlin: Wagenbach 2002, S. 27.*
Thomas Bernhards Hörensagen-Stil, der sich hier zu erkennen gibt, sollte soweit bekannt sein, äußert Piglia 1995 in einem Seminarraum der Universidad de Buenos Aires: »Wie Sie wissen, kulminiert die Unabhängigkeit des Erzählers in den halluzinatorischen Monologen von Thomas Bernhard« (»Como ustedes saben, la independencia del narrador culmina en los monólogos alucinatorios de Thomas Bernhard«, Piglia 2019: 85, Übers. J. W.). Doch taucht Bernhard später auch noch namentlich in einem Brief auf, in Form eines nicht näher benannten, doch aber gelobten Buches:
Hier gibt es wenig Neues, eine Affenhitze; wenn man bedenkt, dass Miguel Cané in dieser Stadt seine Juvenilia geschrieben hat. Ein Grund mehr abzuhauen, wie Alfredo sagt. Aber wohin? Um Mexiko ist es nicht anders bestellt. Ich bin den ganzen Tag in meinem Zimmer eingesperrt und übersetze (im Moment ein ziemlich bemerkenswertes Buch von Thomas Bernhard).
Piglia: Künstliche Atmung, S. 68.**
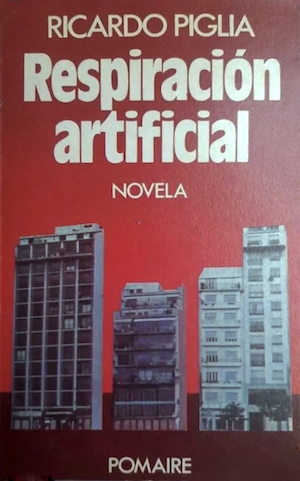
Piglias eigene Lektüreempfehlungen führen nicht nur zu Bernhard, sondern auch zu anderen argentinischen Bernhard-Fans (vgl. Pola Oloixarac, Juan José Saer). Im Roman werden Autor:innen, die stilistisch weniger stark nachhallen, deutlich ausführlicher von den Romanfiguren besprochen, die sich seitenlang über Literaturgeschichte und -theorie unterhalten, vor allem über Jorge Luis Borges. Im Bereich der deutschsprachigen Literatur stechen neben Brecht und Kafka Witold Gombrowicz’ Leben und Schreiben hervor, ebenso Ludwig Wittgenstein, dessen Name und Theorien auch in Bernhards Werke Korrektur (1975), Ritter, Dene, Voss (1986) und Wittgensteins Neffe (1982) eingeflossen sind, wobei Piglia das in letzterem behauptete Verwandtschaftsverhältnis zwischen Paul und Ludwig Wittgenstein in seiner Figurenkonstellation Maggi-Renzi reproduziert. Die Familie als solche findet als eine »blutbefleckte Institution, eine verwerfliche Amputation des Geistes« (Piglia 2002: 44; »institución sanguinolente; una amputación siempre abyecta del espíritu«, Piglia 2001: 50) wenig rühmlich Erwähnung, der Haltung vieler Bernhard-Figuren ihren kaum zu entrinnenden »Peinigern« (W14: 414) gegenüber entsprechend. Die Rettung des geistigen Seins ist der Rückzug ins geistige Sein. Ob als Schreibender, der sein großes Werk nie fertigschreibt, oder rein Denkender. Am (Ex-)Senator Lucio Ossorio, im Rollstuhl, führt Piglia das Denken als einzige Aktivität vor, eine ›Reduktion‹ auf Geistigkeit, die Bernhard schon vor seinen autobiografischen Ausführungen über die Bettlägerigkeit in seinen Jugendjahren stilisiert, seinen Geistesmensch regelrecht aufträgt: So dem Fürsten Saurau in Verstörung (1967), ein »Fürst der Bewegungslosigkeit« (Steinert 1983: 88); ihm kann Piglia zwei Jahre vor Erscheinen von Respiración artificial begegnen in der spanischen Übersetzung Trastorno (1978), die »eines der wichtigen Vorbilder« (Kämmerlings 2002) für seinen Roman werden wird.
Magdalena Kanov, 7. April 2022.
Zitate im Original
* »Pero, escribía el mismo Ossorio (me escribe Maggi), ¿qué es el exilio sino una forma de la utopía? El desterrado es el hombre utópico por excelencia, escribía Ossorio, me escribe Maggi, vive en la constante nostalgia del futuro.« (Piglia 2001: 31)
** »Aquí pocas novedades, mucho calor; pensar que en esta ciudad Miguel Cané escribió Juvenilia. Razón de más para irse, como dice Alfredo. Pero ¿adónde? México es la misma vaina. Vivo encorrado todo el día traduciendo (ahora un libro bastante notable de Thomas Bernhard).« (Piglia 2001: 77)
Literaturverzeichnis
Bernhard, Thomas: Erzählungen, Kurzprosa [= Werke 14], hg. von Hans Höller, Martin Huber und Manfred Mittermayer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003.
Kämmerlings, Richard: »Nachtclub der toten Dichter. Geschichtsträumer: Der argentinische Romancier Ricardo Piglia«. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. September 2002.
Piglia, Ricardo: Respiración artificial [1980]. Barcelona: Editorial Anagrama 2001.
Piglia, Ricardo: Künstliche Atmung. Roman, übers. von Sabine Giersberg, mit einem Nachwort von Leopold Federmair. Berlin: Wagenbach 2002.
Piglia, Ricardo: Teoría de la prosa, hg. von Luisa Fernández. Buenos Aires: Eterna Cadencia 2019.
Steinert, Hajo: Das Schreiben über den Tod. Von Thomas Bernhards Verstörung zur Erzählprosa der siebziger Jahre. Bern: Lang 1983.

