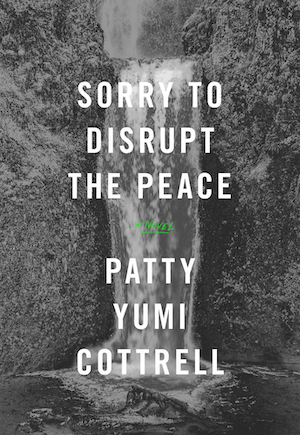Patrick Cottrell
Patrick Cottrell
(Geb. 1981 in Südkorea)
Patrick Cottrell wurde von einer US-amerikanischen Familie gemeinsam mit zwei weiteren, mit ihm nicht verwandten koreanischen Kindern adoptiert. Er wuchs als Patty Yumi Cottrell in Pittsburgh, Chicago und Milwaukee auf und lehrt heute als Assistenzprofessor an der Universität von Denver Creative Writing und Queer Literature. Sorry to Disrupt the Peace ist sein Debütroman, für den er 2017 unter anderem den Barnes & Noble Discover Award und 2018 den Whiting Award erhielt.
Cottrell legt den Einfluss, den Thomas Bernhard auf sein Werk hat, an vielen Stellen offen. In Interviews hat er Bernhard als Inspirationsquelle genannt und Parallelen zwischen seinen und Bernhards Charakteren aufgezeigt, in sozialen Medien und Social-Reading-Plattformen verleiht er seiner Bewunderung für Bernhards Schreiben Ausdruck. Auch für Bernhards ›Schreibkerker‹, die in ihrer Vierkantgroßzügigkeit verschiedener nicht sein könnten als Cottrells eigene Schreiborte (wenngleich Bernhards frühes Schaffen mit einem Speisekammer-Arbeitsplatz bei seiner ›Tante‹ Hedwig Stavianicek in Wien begann):
I love looking at images of Thomas Bernhard’s houses in Austria, how their exteriors seem harsh and weird, like his writing. That mirroring between his houses and his writing appeals to me, maybe because I’ve been a lifelong renter, scrounging around for scraps to inhabit. You never saw where I lived in Brooklyn, but my bedroom was windowless, the walls were curved, there was a foot of space between the bed and these dressers that had been in the bedroom for years before we moved in. One day, I was cleaning behind them and I found a few bullets.
Anne K. Yoder: »Encouraging People To Fail: The Millions Interviews: Patrick Cottrell«, in: The Millions, 22. März 2017.
In einem solchen Apartment finden sich die Lesenden mit dem ersten Satz von Sorry to Disrupt the Peace (2017) wieder: Helens Bruder hat sich umgebracht. Die beiden nicht blutsverwandten Geschwister wurden als Kleinkinder von einem weißen Ehepaar adoptiert und sind in den Vereinigten Staaten aufgewachsen. Helen ist bereits im Teenageralter nach New York übersiedelt und hat seitdem kaum Kontakt zu ihren Adoptiveltern. Ihr Adoptivbruder dagegen ist nie aus seinem Kinderzimmer ausgezogen. Helen beschließt, seinem Suizid auf den Grund zu gehen, reist nach Milwaukee und wird dabei mit ihren entfremdeten Adoptiveltern, entfernten Verwandten und ehemaligen Bekannten konfrontiert, die Helens Umgang mit dem Suizid des Adoptivbruders nicht verstehen können oder wollen.
September 30th, the day I received the news of my adoptive brother’s death, I also received a brand-new couch from IKEA. To clarify, I was the only one who happened to be physically present the day my roommate Julie’s brand-new couch arrived at our shared studio apartment in Manhattan. That day my phone did not stop ringing because my roommate Julie listed my phone number as the main contact for the furniture-delivery company instead of her own. The delivery driver called multiple times because he could not find the apartment building. There was a mix-up on the invoice or the address of the apartment had been smudged into a black thumbprint, also, at the time, a large green trash receptacle the size of a dump truck was placed in front of the building, which blocked the view of the numbers above the front door.
Patty Yumi Cottrell: Sorry to Disrupt the Peace, Sheffield: And Other Stories 2017, S. 1.
Am Beginn steht die Todesnachricht. Die Todesnachricht und eine IKEA-Couch. Der Bruch des Alltags und der Alltag, der sich nicht brechen lässt, der sich stetig in den Vordergrund drängt und zum Weitermachen zwingt (vgl. auch Parks). Cottrells Eröffnungssatz verweist auf jenen in Thomas Bernhards Roman Auslöschung (1986), in dem der Protagonist, Franz-Josef Murau, gerade vom Familiensitz Wolfsegg zurückgekehrt und auf den Straßen Roms flanierend, vom Tod seiner Eltern und seines Bruders erfährt. Was in Sorry to Disrupt the Peace folgt, ist laut Klappentext »[a] bleakly comic tour de force that’s by turns poignant, uproariously funny, and viscerally unsettling, this debut novel has shades of Bernhard, Beckett and Bowles«. Als Hommage an Thomas Bernhard gibt sich der Roman in Verabsolutierungen zu erkennen (die Eltern seien »the cheapest people I have ever known«, Cottrell 2017: 11), in Widersprüchlichen und gescheiterter Kommunikation, die Hauptfigur Helen hat anders als Murau noch nicht einmal einen stummen Zuhörer als Gegenüber: »You have to continually see the world in new ways or else you get stuck, I said to no one« (Cottrell 2017: 222).
Helen, die unzuverlässige Erzählerin, ist so selbstbewusst wie egoistisch, so unangepasst wie chaotisch. Sie beschimpft Menschen auf offener Straße, beschafft Schutzbefohlenen Drogen und verpasst schließlich noch das Begräbnis ihres Bruders. Unübersehbar sind in Hinblick auf die Geschwister auch Parallelen zur eigenen Biografie des Autors. Cottrell begegnete diesem Faktum in mehreren Interviews mit der Aussage, dass es sich bei seinem Buch um ein »Anti-Memoir« handle, das unmittelbar an das Antiautobiografie-Projekt des Helden Franz-Josef Murau (basierend auf dem verlorengegangenen Antiautobiografie-Projekt seines Onkels Georg) in Auslöschung angelehnt sei, mit der Murau seinen Herkunftskomplex samt NS-Schatten der Eltern auslöschen will. Cottrell folgt Bernhard ausdrücklich in diesem erzählerischen Manöver einer »Konstruktion des Textes aus einzelnen Elementen, die man als seine ›vorweggenommene Dekonstruktion‹ bezeichnen könnte« (Marten 2018: 150; vgl. Luchette 2017).
Auch in Sorry to Disrupt the Peace ist der Herkunftskomplex der südkoreanischen Adoptivgeschwister eines der zentralen Themen. Es äußert sich als kritisches Verhältnis der Protagonistin zur neuen Heimat, zur nicht nur freiwilligen Assimilation auch des Adoptivbruders an das Leben der Adoptiveltern: »When he played Mozart or Schubert the house filled up with white male European culture« (Cottrell 2017: 99). Aufgewachsen wie Amerikaner:innen kennen die Geschwister weder die Kultur ihres Herkunftslandes noch werden sie aufgrund ihres ethnischen Hintergrundes als echte Mitglieder des amerikanischen Kulturkreises akzeptiert. Helen selbst wünscht nicht nur die größtmögliche Distanz und den Kontaktabbruch zu ihren Adoptiveltern, sondern verschließt sich auch ihrem Geburtsland. Sie versucht gar nicht erst, ihre leiblichen Eltern zu finden, hat kein Interesse an Südkorea. Konträr dazu verhält sich ihr Adoptivbruder, der nie aus dem Elternhaus auszieht und dann entgegen Helens Rat plötzlich Kontakt zur leiblichen Mutter sucht, sogar nach Korea fliegt mit diesem Ziel. Die Herkunftssehnsucht führt schließlich zu seinem Selbstmord. Nach dem gescheiterten Kennenlernversuch beschließt er, Lebendorganspender zu werden und, nachdem auch dieses Vorhaben scheitert, sich das Leben zu nehmen. Radikalisiert wird mit der noch zuletzt namenlosen Figur des Adoptivbruders in Sorry to Disrupt the Peace die in ihrem Gelingen zwar vage bleibende Auslöschung, die Murau ebenfalls nicht überlebt, die jedoch unausgelöscht den Lesenden als Roman Auslöschung vorliegt: »Da diese Antiautobiografie meines Onkels nicht mehr da ist, habe ich selbst ja sogar die Verpflichtung, eine rücksichtslose Anschauung von Wolfsegg vorzunehmen und diese rücksichtslose Anschauung zu berichten.« (W9: 155)
Judith Pallitsch, 27. Mai 2022.
Literaturverzeichnis
Bernhard, Thomas: Auslöschung. Ein Zerfall [= Werke 9], hg. von Hans Höller. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. S. 7.
Cottrell, Patrick [Patty Yumi]: Sorry to Disrupt the Peace. Sheffield: And Other Stories 2017.
Cottrell, Patrick [Patty Yumi]: https://patrick-cottrell.com/.
Cottrell, Patrick: »How Autofiction Has Taken the Pressure Off Character Transformation. In Conversation with Jordan Kisner on the Thresholds Podcast«. In: Literary Hub, 16. Juni 2021.
Cottrell, Patty Yumi: »I’m not trying to hide anything – the novel is not a memoir«. Interview mit Richard Lea. In: The Guardian, 18. Mai 2017.
Luchette, Claire: »Patrick Cottrell: Writing is Not Therapeutic in Any Way. On Morality, Penis Lesions, and Writing From Life (or Not)«. In: Literary Hub, 21. März 2017.
Marten, Catherine: Bernhards Baukasten. Schrift und sequenzielle Poetik in Thomas Bernhards Prosa. Berlin, Boston: De Gruyter 2018.
Yoder, Anne K.: »Encouraging People To Fail: The Millions Interviews: Patrick Cottrell«. In: The Millions, 22. März 2017.